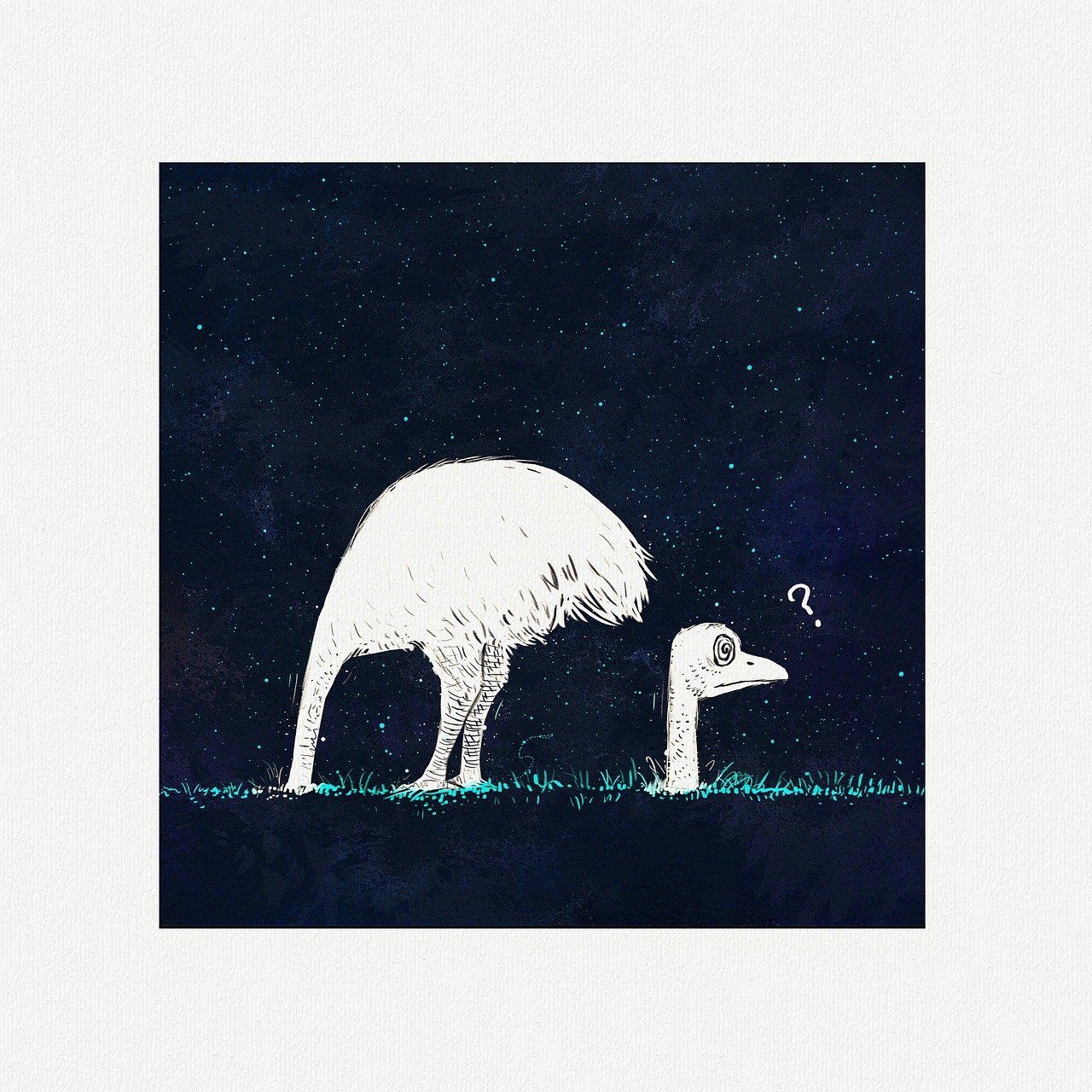Ein berüchtigtes Beispiel für fehlerhafte Forschung ist die Veröffentlichung von Andrew Wakefield, die 1998 im medizinischen Fachjournal „The Lancet“ erschien. Wakefield behauptete dort, einen Zusammenhang zwischen der Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR-Impfung) und Autismus bei Kindern gefunden zu haben. Obwohl „The Lancet“ die Studie später zurückzog und Wakefield die ärztliche Zulassung entzogen wurde, hält sich der Glaube an einen Impf-Autismus-Zusammenhang in der Impfgegnerszene bis heute.
Dieser Fall zeigt, wie eine einzelne fehlerhafte Studie weitreichende Folgen für die öffentliche Gesundheit haben kann. Heute hat sich das Problem durch Hunderttausende von Fake-Publikationen eher noch verschärft.
Wie erkennt man also vertrauenswürdige Quellen? Mit dem 5-Schritte-Check finden Sie es heraus.
Wenn Sie tiefer in die Kunst der Recherche eintauchen möchte, begleite ich Sie gerne weiter – in meiner Reihe wissenschaftliche Quellen bewerten.
1. Autor prüfen: Wer steckt hinter der wissenschaftlichen Quelle?
Würden Sie Ihre Gesundheit einer anonymen Webseite anvertrauen? Wohl eher nicht. Bei wissenschaftlichen Publikationen sollte es nicht anders sein.
Seriöse wissenschaftliche Autorinnen und Autoren haben in der Regel:
- relevante akademische Abschlüsse und Fachkenntnisse
- Publikationen in renommierten Fachzeitschriften
- eine Verbindung zu anerkannten Forschungseinrichtungen
Extra-Info: Ist der Autor wirklich ein Experte?
Je öfter ein Wissenschaftler zitiert wird, desto einflussreicher ist er im Fachbereich. Google Scholar bietet Kennzahlen wie den Hirsch-Index (h-index) an, um die weltweite wissenschaftliche Relevanz einer Person zu bewerten. Der Index zeigt an, wie oft Publikationen dieses Autors in Publikationen anderer Autoren zitiert worden sind. Dies zeugt von einer gewissen Anerkennung in der wissenschaftlichen Community.
Praxisbeispiel: Alternativ kann man den Namen in die Suchmaske einer medizinischen Literaturdatenbank wie „Medline“ angeben und die Trefferliste durchsehen. Wenn ich dort zum Beispiel „Christian Drosten“ AND „virus“ eingebe, erhalte ich 556 Treffer (April 2025). Wiederhole ich dieselbe Suche für „Sucharit Bhakdi“ AND „virus“ ergibt dies lediglich 5 Treffer. Sie sehen, daran lässt sich schon Einiges ablesen….
2. Publikationsort bewerten: Wo wurde die Quelle veröffentlicht?
Gefälschte Studien sind kein Einzelfall, sondern ein wachsendes Problem in der biomedizinischen Forschung. Wie groß das Ausmaß tatsächlich ist, zeigt eine aktuelle Analyse von Bernhard A. Sabel.
Extra-Info: Wie groß ist das Problem gefälschter Studien?
Berndhard A. Sabel, Neurowissenschaftler und ehemaliger Herausgeber der Fachzeitschrift Restorative Neurology and Neuroscience, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema gefälschter wissenschaftlicher Publikationen. In einer ersten Analyse von rund 16.000 Fachartikeln schätzte er, dass etwa 16 % der biomedizinischen Arbeiten seit 2010 gefälscht sind. Hochgerechnet wären das rund 245.000 Artikel allein im Jahr 2023. Gemeinsam mit Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung berechnete er, dass 2020 rund 28 % der weltweit veröffentlichten biomedizinischen Fachartikel unter Fälschungsverdacht standen. Das sind geschätzt mehr als 300.000 gefälschte Publikationen pro Jahr!
Zur Erkennung potenzieller Fälschungen nutzten Sabel und sein Team einfache Kriterien:
- private E-Mail-Adressen in Kombination mit der Angabe einer Klinik als Arbeitgeber,
- Mangel an internationalen Ko-Autoren,
- fehlende oder widersprüchliche Angaben zur Institution,
- wiederkehrende Co-Autorenmuster über mehrere Publikationen hinweg,
- unplausible Zeitabstände zwischen Einreichung und Veröffentlichung (zum Beispiel eine Publikation nur wenige Tage nach Einreichung),
fehlende Antworten der Autoren auf Nachfragen.
Sabel selbst nennt dies „den größten Wissenschaftsbetrug aller Zeiten“.
Gerade weil der Anteil an manipulierten oder unseriösen Arbeiten zunimmt, ist es wichtig zu prüfen, wo eine Quelle erschienen ist.
Vorsicht Falle: „Raubverlage“ (Predatory Journals) veröffentlichen gegen Bezahlung nahezu jeden Artikel. Ohne jegliche Qualitätsprüfung. Warnsignale sind:
- extrem hohe Akzeptanzraten
- keine echte Qualitätsprüfung (Peer-Review)
hohe Veröffentlichungsgebühren (die locker bei 25.000 Euro oder mehr liegen können).
Praxistipp: Werfen Sie einen Blick auf die Webseite der Zeitschrift. Seriöse Fachjournale wie The Lancet oder New England Journal of Medicine informieren offen über ihr Begutachtungsverfahren (mehr dazu bei Schritt 3) und verlangen in der Regel keine oder nur moderate Veröffentlichungsgebühren. Plattformen wie die frei zugängliche Beall’s List oder die kostenpflichtigen Cabells Predatory Reports helfen, fragwürdige Journale zu erkennen.
Auch bei Webseiten ist Vorsicht geboten: Seiten ohne Impressum oder mit rein kommerziellen Absichten sind oft problematisch.
3. Qualität der Quelle erkennen: Peer-Review und Transparenz
„Studien zeigen…“ – doch welche Studien? Und wer hat sie überprüft?
Das Peer-Review-Verfahren stellt sicher, dass Fachartikel vor der Veröffentlichung von unabhängigen Experten geprüft werden. Fehlende Peer-Review-Kennzeichnungen sind ein Warnsignal für mangelnde Qualität.
Auch die Methoden und Daten sollten transparent beschrieben sein. Viele Fake-Quellen berufen sich auf Studien, ohne sie aber konkret zu benennen.
Ein weitere Qualitätsmerkmal ist die Zitationsrate. Je häufiger ein Artikel zitiert wird, desto höher ist seine Relevanz und Anerkennung in der Fachwelt. Eine hohe Zitationsrate allein garantiert zwar keine inhaltliche Korrektheit, sie kann aber ein unabhängiges Indiz für die Bedeutung und Qualität der Arbeit sein.
Praxistipp: Seriöse Quellen nennen Details zu Autoren, Titel, Zeitschrift und Erscheinungsjahr. Klinische Studien müssen außerdem meist vor dem Start in einem Studienregister eingetragen werden und erhalten dort eine eigene Registrierungsnummer. Diese sollte dann auch angegeben sein (bei clinicaltrials.gov: „NCT“, gefolgt von einer 8-stelligen Zahl, z.B. NCT1234567). In seriösen Fachzeitschriften finden Sie immer eine genaue Beschreibung der Studiendesigns, verwendeten Methoden und eine ausführliche Literaturliste. Angaben zur Peer-Review-Historie sind in vielen renommierten Journalen über die Webseite oder in den Artikeldetails einsehbar. Fehlen diese Angaben oder sind die Methoden nur oberflächlich beschrieben, ist Skepsis angebracht.
4. Aktualität überprüfen: Ist die Quelle noch relevant?
Würden Sie einer Studie aus den 1960er-Jahren glauben, die behauptet, Rauchen sei ungefährlich? Eben.
Nicht jede Erkenntnis verliert mit der Zeit an Gültigkeit. Grundlagen der Anatomie oder Physik bleiben in der Regel über Jahrzehnte hinweg unverändert. In dynamischen Forschungsfeldern wie der Onkologie, Infektiologie oder Molekularmedizin hingegen entwickelt sich das Wissen rasant: Neue Studien können Theorien widerlegen, Therapieempfehlungen verändern oder diagnostische Kriterien neu definieren.
Gerade in der Medizin entwickeln sich Leitlinien, Therapieempfehlungen und diagnostische Verfahren kontinuierlich weiter. Deshalb sollten Sie bei Fachquellen nicht nur auf das Veröffentlichungsdatum des Artikels achten, sondern auch auf die Aktualität der zitierten Literatur. Systematische Reviews, Metaanalysen oder aktuelle Leitlinien gelten als gute Orientierungshilfe für den aktuellen Stand der Forschung.
Besonders bei Internetquellen ist Vorsicht geboten: Fehlt ein Aktualisierungsdatum oder basiert ein Text auf veralteten oder schlecht dokumentierten Studien, kann dies ein Hinweis auf überholte Informationen sein – selbst wenn der Artikel seriös wirkt.
Praxistipp: Achten Sie auf das Veröffentlichungsdatum – und die Aktualität der verwendeten Studien. Finden Sie aktuelle Reviews, Leitlinien oder große Originalstudien unter den Referenzen, sind Sie auf der sicheren Seite. In dynamischen Forschungsfeldern sollten die meisten zitierten Studien nicht älter als drei bis fünf Jahre sein. Bei Grundlagenforschung hingegen können auch ältere Arbeiten weiterhin relevant sein.
5. Neutralität prüfen: Objektivität und Interessenkonflikte erkennen
Viele Studien werden im Auftrag von Pharmafirmen durchgeführt – nicht aus Profitgier, sondern weil Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Produkte nachzuweisen. Entscheidend ist jedoch nicht nur, wer die Studie finanziert hat, sondern auch, wie unabhängig sie durchgeführt und ausgewertet wurde, wie transparent die Studiendaten offengelegt werden und ob Interessenkonflikte klar angegeben sind.
Seriöse Fachzeitschriften verlangen deshalb eine klare Offenlegung der Interessenkonflikte („Conflicts of Interest“) und der Finanzierung („Funding“). Außerdem muss die Rolle jedes Autors (z. B. bei Studiendesign, Datenauswertung, Manuskripterstellung) klar angegeben und von den Autoren schriftlich bestätigt werden. Diese Transparenz hilft einzuschätzen, ob die Ergebnisse trotz Industriefinanzierung vertrauenswürdig sind. Wenn diese Angaben fehlen oder unvollständig sind, ist Skepsis angebracht.
Auch bei Internetquellen ist Vorsicht geboten bei:
- werbefinanzierten Seiten
- einseitigen oder unkritischen Darstellungen
-
nicht wissenschaftlich anerkannten Portalen und „Alternativmedizin-Blogs“
Wichtig: Eine Finanzierung durch Unternehmen oder Organisationen bedeutet nicht automatisch, dass eine Studie schlecht ist. Entscheidend ist eine saubere Methodik und die vollständige Darstellung der Ergebnisse. Auch kritische Aspekte („Limitations“) dürfen nicht verschwiegen werden.
Praxistipp: Lesen Sie bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen immer die Abschnitte zu Interessenkonflikten und Finanzierung. Bei Internetquellen hilft ein Blick ins Impressum, Betreiber und auf Hinweise zu Werbepartnern, um die Unabhängigkeit besser einzuschätzen.
Fazit: Wissenschaftliche Quellen sicher prüfen – mit dem 5-Schritte-Check
Wissenschaftliche Publikationen haben oft strengere Qualitätskontrollen als Internetquellen. Doch Vorsicht: Auch bei Fachartikeln gibt es schwarze Schafe wie die „Raubtierjournale“ (Predatory Journals). Internetquellen bieten oft schnell zugängliche Informationen, erfordern aber eine besonders kritische Prüfung auf Seriosität, Objektivität und Transparenz.
Mit dem 5-Schritte-Check haben Sie die wichtigsten Kriterien an der Hand:
- Prüfen Sie den Autor und seine Expertise.
- Achten Sie auf seriöse Veröffentlichungsorte.
- Fragen Sie nach, ob die Quelle geprüft und nachvollziehbar ist.
- Checken Sie die Aktualität der Informationen.
- Hinterfragen Sie Neutralität und Objektivität.
Zum Abschluss noch ein kurzes Experiment
Wie leicht das Fälschen von Artikeln geht, zeigt das Satireprojekt FakePaper.app. Dieses Tool produziert mit nur wenigen Klicks täuschend echt wirkende Pseudostudien – komplett mit erfundenen Autoren, Quellen und Fachbegriffen. Probieren Sie es gerne aus!
Ich habe mal testweise den Titel „Cancer is fake: the truth about cancer industries“ (Krebs gibt’s gar nicht: Die Wahrheit über die Krebsindustrie) in FakePaper.app eingegeben. Nach etwa 30 Sekunden erhielt ich dieses Ergebnis:
So sieht die Fake-Publikation aus
Sieht wissenschaftlich aus – ist es aber natürlich nicht. Obwohl, wer weiß? 😉
In diesem Sinne: Bleiben Sie kritisch!